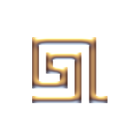Was ist das eigentlich – ein Lebewesen? Es ist mehr als Materie. Es atmet, bewegt sich, reagiert auf die Welt, es isst, pflanzt sich fort, ruht, flieht, jagt oder träumt. Es will überleben – auf seine Weise. Dabei sind die Ausdrucksformen des Lebens so verschieden wie die Erde selbst: Pflanzen streben still zum Licht, Tiere kämpfen, fliehen, rufen, warnen. Und dann gibt es da noch den Menschen. Er passt eigentlich in keine dieser natürlichen Ordnungen so recht hinein, auch wenn er sich selbst biologisch den Tieren zurechnet.
Was ist das eigentlich – ein Lebewesen? Es ist mehr als Materie. Es atmet, bewegt sich, reagiert auf die Welt, es isst, pflanzt sich fort, ruht, flieht, jagt oder träumt. Es will überleben – auf seine Weise. Dabei sind die Ausdrucksformen des Lebens so verschieden wie die Erde selbst: Pflanzen streben still zum Licht, Tiere kämpfen, fliehen, rufen, warnen. Und dann gibt es da noch den Menschen. Er passt eigentlich in keine dieser natürlichen Ordnungen so recht hinein, auch wenn er sich selbst biologisch den Tieren zurechnet.
Wissen Tiere eigentlich, was sie sind?
Eine ehrliche Annäherung an das Wesen der Tiere – und den Irrweg des Menschen.
Tiere leben in der Welt, der Mensch baut sich seine eigene. Das Tier folgt seiner Spur im Wald, dem Geruch des Wassers, dem Sonnenstand am Himmel. Es weiß, was es tun muss – ohne es zu hinterfragen. Der Mensch dagegen hat aufgehört, der Natur zuzuhören. Er denkt, analysiert, vergleicht, zweifelt. Er stellt Fragen, die kein anderes Lebewesen je gestellt hat. Fragen nach Sinn, nach Zukunft, nach Bedeutung. Fragen, die ihn quälen, statt befreien. Und während das Tier nur nimmt, was es zum Leben braucht, will der Mensch mehr – immer mehr.
Kein anderes Wesen hortet Besitz, baut Festungen, erhebt sich über andere oder führt Kriege um Dinge, die es gar nicht essen kann. Kein anderes Wesen hat eine Vorstellung von Reichtum, von Macht, von „mein und dein“. Tiere kämpfen um ihr Leben, nicht um ihr Eigentum. Doch der Mensch hat sich so weit von der Natur entfernt, dass er glaubt, sie sei für ihn da. Als Vorratskammer, als Spielplatz, als Rohstoff. Er besitzt, was er zerstört – und zerstört, was er besitzen will.
 Was Tiere fühlen, bleibt uns im Grunde verborgen. Man sieht es, spürt es – aber man kann es nicht greifen. Ein Blick, ein Laut, ein Zucken mit dem Ohr – all das sagt viel, aber eben nicht in unserer Sprache. Und genau das ist das Problem. Die Welt der Tiere spricht nicht mit Wörtern. Sie spricht mit Bewegung, mit Lauten, mit Gerüchen, mit Stille. Doch der Mensch hört nicht mehr hin. Er versteht nur noch das, was er selbst definiert hat. Deshalb ist jede wirkliche Kommunikation mit den meisten Lebewesen zum Scheitern verurteilt. Nicht, weil sie nichts zu sagen hätten – sondern weil wir verlernt haben, sie zu verstehen.
Was Tiere fühlen, bleibt uns im Grunde verborgen. Man sieht es, spürt es – aber man kann es nicht greifen. Ein Blick, ein Laut, ein Zucken mit dem Ohr – all das sagt viel, aber eben nicht in unserer Sprache. Und genau das ist das Problem. Die Welt der Tiere spricht nicht mit Wörtern. Sie spricht mit Bewegung, mit Lauten, mit Gerüchen, mit Stille. Doch der Mensch hört nicht mehr hin. Er versteht nur noch das, was er selbst definiert hat. Deshalb ist jede wirkliche Kommunikation mit den meisten Lebewesen zum Scheitern verurteilt. Nicht, weil sie nichts zu sagen hätten – sondern weil wir verlernt haben, sie zu verstehen.
Und so bleibt auch ihr Widerstand aus. Nicht, weil Tiere nichts empfinden. Nicht, weil sie es „zulassen“, dass wir sie einsperren, züchten, ausbeuten, töten. Sondern weil sie nicht wissen, womit sie es zu tun haben. Kein Tier versteht unsere Maschinen. Kein Tier durchschaut unsere Pläne, Verträge, Märkte. Kein Tier rechnet mit einem Feind, der in Jahrtausenden denkt, während es selbst nur den nächsten Sonnenaufgang kennt. Der Mensch hat ein Gedächtnis, das weit über sein eigenes Leben hinausreicht. Er erinnert sich an Kriege, die er nie selbst erlebte, an Geschichten, die andere für ihn erfunden haben. Er sorgt sich um ein Morgen, das noch gar nicht begonnen hat. Diese Fähigkeit hat ihn stark gemacht – aber auch einsam. Denn kein anderes Wesen teilt diese Last mit ihm. Er steht allein mit seinen Gedanken – und gerade deshalb ist er so gefährlich.
Es gibt viele Fragen, die offenbleiben. Stammt der Mensch wirklich aus derselben Geschichte wie die Tiere, oder hat er sich einen eigenen Ursprung zurechtgelegt? Ist sein „Ich“ ein echtes Wesen – oder nur ein Trugbild, geboren aus Sprache, Angst und Sehnsucht? Warum braucht er Moral, Schuld, Gesetze – während Tiere einfach nur sind, was sie sind?
Und damit kommen wir zur eigentlichen Frage: Wissen Tiere, was sie sind? Die klare Antwort lautet: Nein. Aber das ist nicht ihr Mangel – sondern ihre Freiheit. Sie müssen es gar nicht wissen. Ein Tier lebt nicht mit einem Plan. Es denkt nicht über sich nach, es träumt nicht von einem besseren Ich. Es ist nicht auf der Suche nach sich selbst – denn es hat sich nie verloren.
Ein Tier reagiert. Es folgt Instinkten, Trieben, Emotionen. Es verspürt Hunger, Schmerz, Angst, Neugier, Lust, Müdigkeit. Es lebt im Jetzt. Nicht in gestern oder morgen. Es macht nichts, was nicht in dem Moment notwendig ist. Und genau deshalb ist es frei von all dem, was den Menschen gefangen hält: Sorgen, Gier, Reue, Hochmut, Zweifel. Tiere fragen nicht, wer sie sind. Menschen tun das. Und vielleicht tun sie es, weil sie es nicht mehr wissen.
Fazit:Am Ende steht nicht die Frage nach dem Tier – sondern die nach uns. Nicht, ob Tiere ein Ich haben – sondern ob wir unseres missbrauchen. Nicht, was Tiere wissen – sondern warum wir alles wissen müssen und doch so wenig verstehen. Vielleicht wäre es besser, wir würden weniger über Tiere nachdenken – und mehr über uns. Was wir hier tun. Warum wir tun, was wir tun. Und was wir vielleicht längst verlernt haben: Einfach zu leben.