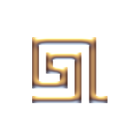Teil 2: Angst, Macht und gesellschaftliche Kontrolle
 Die Gesellschaft hat den Tod zu einem Tabu gemacht.
Wer heute äußert, nicht mehr leben zu wollen, gilt schnell als krank oder gestört.
Der Gedanke, dass jemand freiwillig gehen könnte, wird verdrängt – so, als wäre es unmöglich.
Damit bleibt der Tod ein Werkzeug der Angst, das Menschen bindet und lenkt.
Die Gesellschaft hat den Tod zu einem Tabu gemacht.
Wer heute äußert, nicht mehr leben zu wollen, gilt schnell als krank oder gestört.
Der Gedanke, dass jemand freiwillig gehen könnte, wird verdrängt – so, als wäre es unmöglich.
Damit bleibt der Tod ein Werkzeug der Angst, das Menschen bindet und lenkt.
Schon früh wird vermittelt: Leben sei das höchste Gut, das man um jeden Preis festhalten müsse. Doch in Wahrheit leben Milliarden Menschen in Verhältnissen, die sie kaum ertragen, schweigend und angepasst. Viele fühlen sich fehl am Platz, aber sie äußern es nicht – aus Angst vor Abwertung, Ausgrenzung oder Zwangsbehandlung. So werden innere Wahrheiten systematisch unsichtbar gemacht.
Diese Tabuisierung nützt vor allem jenen, die von der Arbeitskraft und Anpassung anderer leben. Solange Menschen glauben, sie müssten bis zum bitteren Ende durchhalten, bleibt ihr Leben planbar und nutzbar. Wer nicht mehr leisten kann, gilt sofort als „Pflegefall“ – unabhängig von Alter oder wirklichen Wünschen. Der eigene Wille über das Lebensende wird nicht anerkannt.
Selbstbestimmung als Ausweg
Selbstbestimmung über den Tod bedeutet nicht Willkür, sondern Verantwortung. Jeder Mensch weiß, was er möchte oder nicht. Diese Entscheidung ist keine Krankheit – sie ist eine bewusste Reflexion darüber, ob das Leben noch Sinn und Wert hat. Das Recht, diese Wahl zu treffen, würde Machtmissbrauch entziehen und die Angst vor dem Zwangsweiterleben auflösen.
In einer Gesellschaft, die den freiwilligen Tod akzeptiert, gäbe es keine moralische Abwertung mehr. Wer bleiben will, bleibt. Wer gehen möchte, darf gehen – ohne Druck, ohne Leid, ohne Verstecken. Die Verantwortung verschiebt sich dann von Kontrolle und Verbot hin zu echter Unterstützung: Entweder Hilfe zum Leben oder Hilfe zum Gehen.
Solange der Tod aber als „Versagen“ gilt, bleibt er Spielball der Mächtigen. Erst wenn Menschen ihn als natürlichen Ruhezustand anerkennen, der genauso wie die Geburt eine Schwelle markiert, entsteht Freiheit. Der erste selbstbestimmte Schritt des Menschen wäre dann nicht Arbeit oder Pflicht, sondern die letzte Entscheidung über sich selbst.
Weiter in Teil 3
Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, welche praktischen Strukturen nötig wären, um Selbstbestimmung wirklich umzusetzen – ohne Missbrauch, ohne Tabus, aber mit Klarheit und Sicherheit für alle.